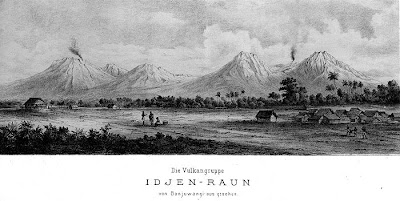Nun ist Felix schon den dritten Tag in New York, und es stimmt also, Amerika existiert, Felix hat es mit eigenen Augen gesehen, die Brooklyn Bridge gibt es tatsächlich, und die Skyline von Manhattan, wenn man mit der Fähre nach Long Island fährt, an der Freiheitsstatue vorbei, die kleiner als erwartet und etwas verloren auf einem Inselchen hockt, oder steht, ist ebenfalls nicht nur aus einem Film, und ja, die Zwillingstürme sind wirklich nicht mehr da, Felix hat es mit eigenen Augen geprüft, dazu hat er eigens und trotz Flugangst (die allerdings mit Seresta etwas gedämpft wurde) die acht Stunden Flug von Zürich-Kloten nach New York JFK auf sich genommen. Es ist arschkalt in New York, jedenfalls war es das bis heute, jetzt ist Tauwetter angesagt, es war also arschkalt die letzten Tage und vor allem gestern war es geradezu sibirisch, auch wenn man sich das in den USA kaum zu schreiben getraut, angesichts des früheren Erzfeindes, aber es war auch absolut grossartig, wegen dieses Lichts, das es nur dann gibt, wenn es so klar und trocken und kalt ist wie soeben, Schönheit hat eben ihren Preis. Der Central Park ist also tief verschneit, auf einem zugefrorenen Weiher laufen die New Yorker an diesem freien Montag Schlittschuh (es ist Presidents Day, das hat etwas mit George Washington zu tun, der wahrscheinlich heute vor plusminus 200 Jahren geboren wurde, und im Fernsehen werden die ganze Woche schon die Amischlitten mit Presidents-Day-Rabatt angeboten), das Licht ist glitzernd und perlend und absolut umwerfend und fast noch schöner sind die Schatten, die dieses Licht wirft, die Schatten, die sich in den Formen und Linien der Architektur verlieren, und das Blau des Himmels, das sich abhebt gegen das unwahrscheinliche, fast schon surrealistische Panorama der Wolkenkratzer, das den rechteckigen Park umgibt, und die über den Schnee huschenden Eichhörnchen wollen natürlich in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden – ein bisschen Davos oder Sankt Moritz mitten in New York, wer hätte das erwartet?
Der Flug war kürzer als die neun Stunden, die angekündigt waren. Die Kontrollen bei der Einreise hat Felix sich auch schlimmer vorgestellt, Felix wird zwar fotografiert und ein Abdruck seines Daumens wird ihm auch abgenommen, das geht aber ganz schnell und routinemässig und die Beamten heissen halt Officer und nicht Grenzbeamte wie bei uns. Der junge schwarze Mann, der die Gäste für den Shuttle-Bus einsammelt, von Terminal eins bis neun, nennt Felix Papa, das ist aber nicht bös gemeint, so nennt er alle älteren Semester, nein, es macht Felix nichts aus, von einem jungen Mann, der sein Sohn oder schon fast sein Enkel sein könnte, Papa genannt zu werden (allerdings müsste dessen Mama, wenn Felix denn der Papa sein sollte, schon sehr schwarz sein), da guckt die elegante Dame, die der junge Schwarze Mama nennt, schon betupfter. Vom JFK aus fährt man etwa eine halbe Stunde lang rüber nach Manhattan, aber schon bald taucht die Skyline von Manhattan im Blickfeld auf: ein erster Höhepunkt der Reise. Rechts fällt der Blick auf einen Riesenfriedhof mit den Ausmassen einer kleinen Stadt, es ist der jüdische Beth Olom-Friedhof. Und schon hält der Bus in der Nähe der Grand Central Station, und von da sind es nur noch ein paar Schritte bis zum Hotel von Felix. Dieses Hotel ist absolut angemessen. So soll man in New York wohnen, denkt Felix befriedigt. Die Eingangshalle ist fast so grossartig wie die des Waldorf Astoria, mit Kristalllüstern und livrierten Kellnern oder so und natürlich mit einem Porträt von Präsident Roosevelt. Aber das Frühstück muss man sich in der edlen Halle bei Starbucks – in New York allgegenwärtiger als McDonalds – erstehen. Dann ist Felix bereits auf ausgedehnten Stadtwanderungen zwischen South Ferry und ganz oben beim Central Park, er ist auf der Brooklyn Bridge, er ist im Village (daselbst in der legendären Stonewall-Bar), er ist auf dem Empire State Building, im Museum of Art, aber nur im Eingangsbereich, da zu viele Leute (Presidents Day), auf der Fähre nach Staten Island und mehrmals zum Apéro in der wunderbaren Architektur der Grand Central Station (die Bars sind wirklich gediegen, wenn auch die Preise gesalzen, und das sowieso, NYC ist definitiv keine Stadt für Sparer – und keine für Raucher, denn rauchen darf man höchstens auf der Strasse, aber ganz sicher nicht in einer Bar).
Das Hotel Roosevelt, Ecke Madison Ave und 45th Street, ganz in der Nähe von Grand Central Station und Empire State Building, komme ihm kafkaesk vor, irgendwie, meint ein deutscher Geschäftsreisender, während er aus dem Lift tritt, zu seiner Begleiterin. Kafka, der unseres Wissens nie in Amerika war, hat ja tatsächlich einen Roman mit dem Titel «Amerika» geschrieben – Felix hat ihn vor vielen Jahren in Marokko gelesen, er hat ein zerfleddertes Exemplar dieses Titels in der Jugendherberge von Rabbat gefunden. In diesem Buch steht der Satz: «Als der sechzehnjährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickt er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.» Warum dem deutschen Geschäftsmann das Hotel Roosevelt kafkaesk vorkommt, kann Felix allerdings nur erraten, denn jetzt ist dieser Geschäftsmann samt Begleiterin schon um die Ecke verschwunden. Der Lift ist übrigens genau so, wie ein Lift in einem amerikanischen Hotel zu sein hat: irgendwie verspiegelt, altmodisch, asthmatisch keuchend, leider aber ohne hübschen Bellboy. Der Eingangsbereich ist grossartig, fast wie die Empfangshalle eines Theaters, mit Säulen, Stuckaturen, Marmorboden, Kronleuchtern, vergoldeten Verziehrungen, Jugendstil. In New York zu sein, hat für Felix übrigens auch etwas mit einem gewissermassen kafkaesken Gefühl der Unwirklichkeit zu tun, weil er an jeder Ecke an so vieles erinnert wird, dem er schon begegnet ist – im Film, auf Plakaten, auf Fotos –, das in der Realität aber ganz anders wirkt, in seiner dreidimensionalen Körperhaftigkeit, grösser, gleichzeitig gewöhnlicher und vielleicht gerade dadurch auch wieder spektakulärer. Felix begegnet im MoMA, dem Museum of Modern Art, und das ist an sich schon ein fast surreales Erlebnis, unzähligen Bildern, die er
schon hundertfach reproduziert auf Plakaten, Postkarten, in Kunstbüchern etc. gesehen hat, die kann er nun im Original bewundern, also in Originalgrösse und in Originalfarben, gerade zum Beispiel die Surrealisten, Dalis zerlaufende Uhren, Magrittes Trug-Bilder, aber natürlich auch die Picassos, Degas, Monet, oder die Amerikaner wie Rothko, Rauschenberg, Jackson Pollock natürlich oder auch Edward Hopper. Erstaunlicherweise hat Felix das Gefühl, dass die Originale viel unechter wirken als die Kopien. Das Museum selbst ist allein schon ein visuelles Ereignis; das neue MoMA ist ja erst etwa zwei Jahre alt und wurde von einem japanischen Architekten gebaut oder umgebaut.
Felix ist vor allem zu Fuss unterwegs, als Stadtwanderer in den Wanderschuhen, die er auch trägt, um in Zürich auf den Hausberg, den Üetliberg, zu wandern oder vielmehr in robertwalserscher Manier zu spazieren. Manchmal ist er auch mit der rumpelnden und rasselnden Subway unterwegs, die er sich auch irgendwie gefährlicher vorgestellt hat; das Gefühl, in dieser Subway zu fahren, ist aber kein anderes als das Gefühl, in Zürich in der S-Bahn oder im Tram zu hocken – nur, dass die New Yorker wohlerzogener wirken als die Zürcher (und dass es in Zürcher Trams mehr durchgeknallte Typen zu haben scheint als in der New Yorker Sub). Aber es ist natürlich interessanter, zu Fuss unterwegs zu sein, vor allem in dieser Stadt, und Felix ist also unterwegs von der Südspitze Manhattans in den Norden, ist unterwegs im Village und im Central Park oder am Times Square, beobachtet und macht Fotos und, wir schwören es, er wird dabei mindestens ein Dutzend mal nach dem Weg gefragt, trotz oder gerade wegen der Wanderschuhe an seinen Füssen, und zwar nicht von japanischen Touristen, sondern von waschechten Amis! Das macht ihn ganz stolz, unseren Touristen aus den Schweizer Bergen. In solchen Momenten merkt er bei sich, dass er der Sohn seines Vaters ist, der in genau so einer Situation ebenfalls stolz auf sich gewesen wäre.